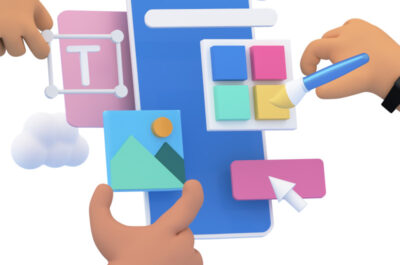Eine neue Generation von Startups begreift Journalismus nicht als Produkt, sondern als Prozess. Auf Carta.info erklärt der Journalist Frederik Fischer, was das für den Journalismus bedeutet.
Etablierte Medien, die die neue Netzwerkstruktur verstehen und sich darauf einlassen, können sich wieder auf ihre Alleinstellungsmerkmale konzentrieren. Voraussetzung: Ein tiefgreifender Mentalitätswechsel der Amateure und Softwareentwickler, als Selbstverständlichkeit in den journalistischen Produktionsprozess integriert.
Rührig steht Marcus Jordan inmitten des re:publica-Gewirrs am Stand von Torial und erklärt den ganzen Tag leidenschaftlich, warum Journalisten seinen Dienst nutzen sollen. Torial ist eine sehr schön aufbereitete Portfolio-Seite mit Netzwerkfunktion. Torial ist außerdem eines von zahllosen ambitionierten Projekten, die maßgeschneidert wurden für die Ansprüche von deutschen Journalisten, diese aber mehrheitlich kaum interessieren.
Dafür mag es im Einzelfall gute Gründe geben. In der Summe führt der regelmäßige wirtschaftliche Misserfolg von Startups wie Torial, die Journalismus für sich als Kernmarkt definieren, aber dazu, dass Gründer und Investoren nicht mehr bereit sind, Geld und Zeit in diesen Markt zu investieren.
Vom Produkt zum Prozess
Das ist bedauerlich, denn wenn es eine Branche gibt, die Innovationen willkommen heißen muss, dann ist es der Journalismus. Auch in Zeiten engst geschnallter Gürtel erlaubt sich die Branche eine Redundanz und Ressourcenverschwendung, als gäbe es noch Platz dafür.
Dabei ist “weiter so“ längst keine Option mehr. Es bedeutet in diesem Kontext vor allem das Festhalten an der irrigen Annahme, Journalismus sei ein Produkt in Form eines Textes, Bildes oder Rundfunkbeitrags. Das termingerechte Füllen der Seite bzw. des Sendeplatzes wird so zum unmittelbaren Ziel, die Einzigartigkeit und Qualität der Inhalte kommen erst an zweiter Stelle.
Sämtliche Strukturen haben sich um die Auslieferung formatierter Produkte gebildet – und verhindern nun nötige Veränderungen. Tatsächlich sind die vermeintlichen Produkte aber nur Schritte in einem Prozess. Ein Prozess in dem nur noch wenige Schritte tatsächlich von klassischen Journalisten ausgeübt werden müssen – und können.
Was ausgegliedert werden kann, muss ausgegliedert werden
Die schwedische Medienberaterin Annette Novak:
„Die Redaktionen sind immer dünner besetzt, es ist für sie daher zwingend nötig, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Alles, was ausgegliedert oder automatisiert werden kann, muss daher ausgegliedert und automatisiert werden“
„Das Wesentliche“ ist für Novak dabei gesellschaftlich relevanter Journalismus, im Englischen auch „public service journalism“ genannt. Ein Journalismus, der sich darauf versteht, souverän durch das Überangebot an Informationen zu navigieren, und den Menschen Orientierung und Kontext bietet. Nicht mehr Ausspielungen pro Tag, sondern mehr Sinnstiftung pro Ausspielung sollte der Gradmesser des Erfolgs sein.
Öffnung nach außen
Unter dem steigenden Zeitdruck und vor dem Hintergrund einer zunehmend komplexen Welt, stoßen Journalisten dabei immer häufiger an ihre Grenzen. Eine Öffnung nach außen kann hier helfen, denkt Netz-Theoretiker Christoph Kappes:
„Zum journalistischen Prozess gehört eine Vielzahl an Arbeitsschritten: Themenrecherche, Interviews und Verifizierung oder die fachliche und rechtliche Beurteilung von externem Material. Einiges davon kann von qualifizierten Lesern und Experten übernommen werden.“
Aber nicht nur Leser und Experten sollten als Teil des Prozesses begriffen werden.
Ein Netzwerk aus Nischen-Dienstleistern
In den letzten Jahren hat sich vor allem im englischsprachigen Ausland ein dichtes Netz an Startups, Nischen-Agenturen und Stiftungen gebildet, die sich gezielt auf bestimmte Prozessschritte konzentrieren und somit eine wichtige Funktion im sich stetig weiter ausdifferenzierenden Medienproduktions-Netzwerk besetzen.
Von der Themenfindung auf Pitch.me über die Suche nach nutzergenerierten Fotos und Videos auf Demotix bis hin zur Verifizierung von Social Media Inhalten durch Storyful und der Verwaltung und Veröffentlichung der Ergebnisse mit Open Source Redaktionssystemen von Sourcefabric: Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Für nahezu jeden Schritt im Produktionszyklus journalistischer Werke gibt es mittlerweile spezialisierte Anbieter – die meisten davon softwaregestützt.
Automatisierung und Ausgliederung
Sicher: Einige dieser Angebote erfordern kurzfristigen Mehraufwand und belasten das knappe Budget, aber langfristig senken sie die Kosten, entlasten Journalisten und erlauben ihnen, sich auf die Kernkompetenzen – gründliche Analyse und Kontextualisierung – zu konzentrieren. So steigt die Chance, einen echten Mehrwert im Vergleich zum austauschbaren Hintergrundrauschen der On- und Offline-Konkurrenz zu schaffen.
Gegen Umsonst-Anbieter kann man keinen Preiskampf gewinnen
Ziel der Umstellung muss daher sein: Besseren, nicht günstigeren Journalismus zu produzieren. Möglich wird dies, indem sich Redakteure für jeden Prozessschritt, der nicht unmittelbar zur Steigerung des Alleinstellungsmerkmals beiträgt, Leser-Experten, nutzergenerierter Inhalte und Startups bedienen.
Sonderfall Deutschland
Im Weg steht dem Umdenken hierzulande jedoch ein Verständnis von Journalismus, das sich seit über 100 Jahren kaum verändert hat. Demzufolge ist Journalismus eine Mischung aus Kunst- und Handwerk, die weder als Ganzes noch in Teilen als von der Person des Journalisten getrennt verstanden werden kann. Möglicherweise ist es diesem Standesdenken zuzuschreiben, dass die oben genannten Startups zwar die größten internationalen Medienmarken – von der New York Times über Al Jazeera bis zu Reuters –, kaum jedoch ein deutsches Medienunternehmen zu ihren Kunden zählen.
Ein möglicher Grund ist aber auch die Technologie-Aversion hiesiger Journalisten, die sogar über die Ländergrenzen hinaus schon zum Thema wurde. So sorgt die Twitterphobie deutscher Berlin-Korrespondenten ebenso für Gesprächsstoff, wie Redaktionssysteme aus den 90ern oder die Zusammensetzung der Veranstaltungsreihe Hacks/Hackers. Hier treffen sich in rund 30 Ländern weltweit regelmäßig Journalisten und Entwickler, um gemeinsam an Projekten zu arbeiten. Deutschland ist dabei das einzige Land, in dem weniger Journalisten als Entwickler zu den Treffen erscheinen.
Es kann kein „Weiter so“ geben
Noch können sich deutsche Medienmanager aufgrund teils beträchtlicher Rücklagen und (noch) solider Print-Umsätze bzw. üppiger Gebührenfinanzierung ein gewisses Maß an Bräsigkeit erlauben. Aber eine Fortschreibung des Trends zeigt: Diese Einstellung hat ein eingebautes Verfallsdatum.
Ob radikales Neudenken journalistischer Wertschöpfung zu einem goldenen Zeitalter für die großen Medienhäuser führt, ist freilich zweifelhaft. Die Zeiten sind wohl vorbei. Unzweifelhaft ist jedoch, dass „weiter so“ nicht im Interesse der Verlage und erst recht nicht im Interesse der Leser, Zuschauer und Zuhörer sein kann.
Dieser Beitrag erschien zuerst auf Carta.info.
Artikel per E-Mail verschicken
Schlagwörter: journalismus, medienproduktion, netzwerk, Prozessjournalismus, software, startups