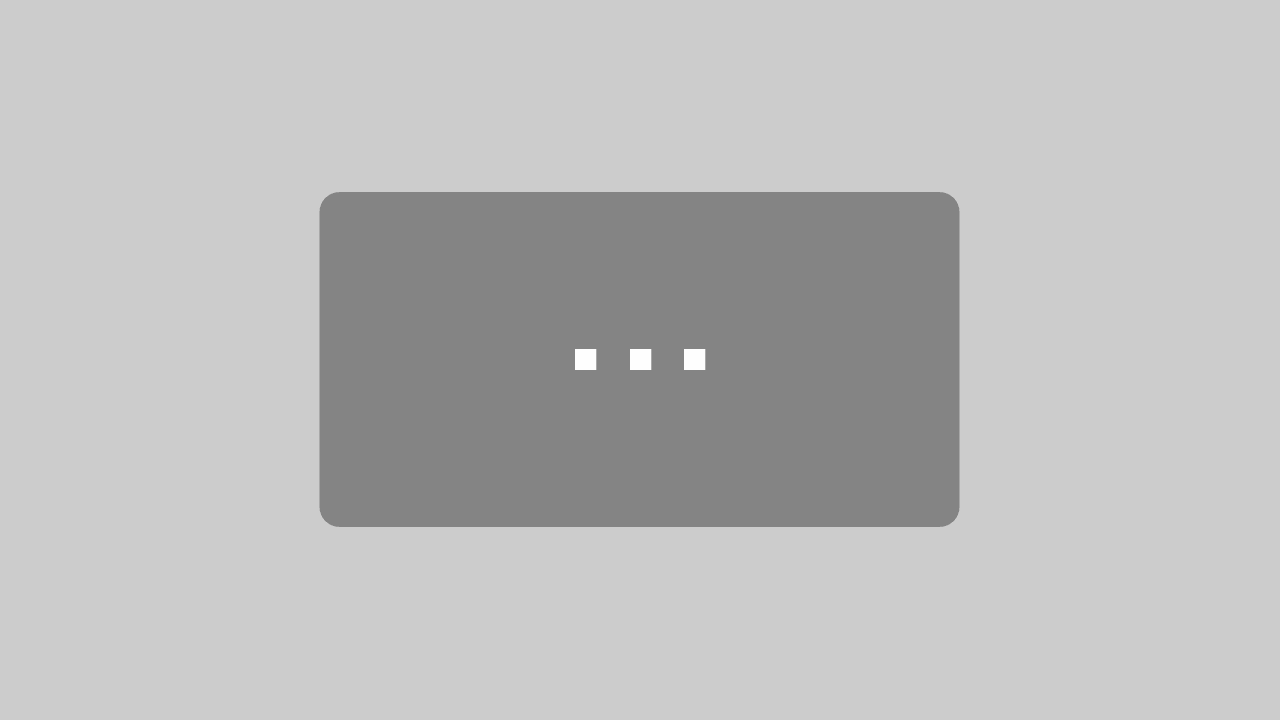Im Dezember 2024 wurde der Digitalpakt 2.0 beschlossen. Dieser baut auf dem DigitalPakt Schule und soll über 6 Jahre insgesamt 5 Milliarden Euro zur Digitalisierung der Schulen bereitstellen. Wir verraten euch, was der vorige DigitalPakt Schule beinhaltete, was der neue DigitalPakt 2.0 verbessert und wo die Strategie zur Digitalisierung von Schulen noch Nachbesserungsbedarf hat.
DigitalPakt Schule: Die Zielsetzung
Von den nackten Zahlen umfasste der DigitalPakt Schule ursprünglich das gleiche wie auch sein Nachfolger: 5 Milliarden Euro zur Digitalisierung der Schulen, verteilt auf 6 Jahre von 2019 bis 2024. Neben Digitalisierungsprojekte für einzelne Schulen sollten damit auch länderübergreifende Vorhaben für die Bildungsinfrastruktur umgesetzt werden. Das war für das föderale Bildungssystem ein großes Novum.
Der DigitalPakt Schule hatte in erster Linie das Ziel, digitale Lernmittel und Technologien in den Schulalltag zu integrieren. Dabei ging es um mehr als nur die Bereitstellung von Computern und Tablets. Es sollten auch die nötige Internet-Infrastruktur, wie leistungsfähige WLAN-Verbindungen, sowie smarte Tafeln und Softwarelösungen zur Unterstützung des Unterrichts bereitgestellt werden. Ein wichtiger Bestandteil war zudem die Förderung von Fort- und Weiterbildungen für Lehrkräfte, um digitale Kompetenzen im Unterricht zu integrieren.
Der DigitalPakt Schule – Digitalisierungsboost durch Pandemie verpuffte
Die Idee war gut, aber die Umsetzung hakte. Bis Anfang 2020 wurde für Hessen, Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt und das Saarland noch kein Projekt bewilligt und überhaupt wurden in den ersten 7 Monaten nur 20 Millionen Euro aus dem 5 Milliarden dicken Paket bewilligt. Grund dafür war vor allem, dass Schulen überhaupt erst ein Medienkonzept erarbeiten mussten, um Mittel aus dem Topf beantragen zu dürfen.
Dann kam Corona und Schulen mussten im Eiltempo fürs Homeschooling flottgemacht werden. Um den dringlicheren Anforderung gerecht zu werden und Schüler*innen mit noch fehlenden Endgeräten auszustatten wurde der DigitalPakt Schule um weitere 1,5 Milliarden erweitert. Bis Juni 2021 wurden trotzdem nicht einmal eine Milliarde des Förderbudgets abgerufen – davon entfiehl der Großteil auf den 500 Millionen Euro großen Topf für Leihgeräte.
Auch wenn der DigitalPakt Schule am Ende als Erfolgsgeschichte verkauft wird, ist der Erfolg ernüchternd. Anstatt auf Erfahrungen aus der Zwangsdigitalisierung während Corona zu lernen, ging es danach eher wieder zwei Schritte zurück. Bitkom-Präsident Achim Berg zog bereits im März 2023 ein wenig schmeichelhaftes Fazit: „In vielen Unternehmen und Verwaltungen hat Corona einen nachhaltigen Digitalisierungseffekt ausgelöst. Ausgerechnet die Schulen sind nach Ende der coronabedingten Einschränkungen aber oft zum alten Modus zurückgekehrt. Viele Schulen drehen das Rad wieder zurück ins Jahr 2019“.
Auch wir kamen letztes Jahr zum Schluss, dass die Digitalisierung an Schulen gescheitert ist. Zugleich sahen wir aber auch Chancen, wenn der Digitalisierungspakt 2.0 strukturierter aber zugleich weniger bürokratisch aufgebaut wird.
Das ist der Digitalpakt 2.0
Entgegen anfänglicher Befürchtungen gibt es für den DigitalPakt Schule nun die Fortsetzung in Form des Digitalpakt 2.0. Ein großer Vorteil: Mittlerweile haben fast alle Schulen Erfahrungen mit dem DigitalPakt Schule. Entsprechend schnell sollten diesmal also die ersten Anträge folgen.
Das Geld kommt zu einer Hälfte vom Bund, zur anderen Hälfte von den Ländern. Das vom Bund beigesteuerte Budget soll zum Großteil in die digitale Bildungsinfrastruktur fließen. Von den 2,5 Milliarden Euro der Länder soll ein Großteil – gut 2 Milliarden Euro – allerdings auch durch Anrechnung von bereits geplanten Ländermaßnahmen erfolgen. Diese Gelder fließen somit nur bedingt in Maßnahmen, die erst durch den Digitalpakt 2.0 angeschoben werden. Als Verteilschlüssel auf die Länder wird wie bereits im DigitalPakt Schule der Königssteiner Schlüssel verwendet. Dieser richtet sich zu zwei Dritteln nach Steueraufkommen und zu einem Drittel nach Bevölkerungszahl. Auch sollen erneut finanzschwache Kommunen berücksichtigt werden.
Der Digitalpakt 2.0 teilt sich in drei Handlungsstränge:
Der erste und größte Handlungsstrang ist der Auf- und Ausbau der digitalen Bildungsinfrastruktur. In diesen sollen 2,25 Milliarden Euro vom Bund und weitere 500 Millionen Euro durch die Länder fließen. Wie schon im DigitalPakt Schule sind dafür auch länderübergreifende Maßnahmen vorgesehen.
Im zweiten Handlungsstrang steht die digitalisierungsbezogene Schul- und Unterrichts-Entwicklung im Vordergrund. Das beinhaltet die flächendeckende Nutzung der digitalen Bildungsinfrastruktur, aber auch die Aus-, Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte. Die Länder setzen jeweils eigene Digitalisierungsstrategien um, stehen jedoch im regelmäßigen Austausch mit Bund und Ländern.
Im Rahmen des dritten Handlungsstrangs soll eine Bundes-Länder-Initiative „Digitales Lehren und Lernen“ vereinbart werden. Ziel sind sind evidenzbasierte Qualitätsentwicklung der digitalen Lehrkräftebildung sowie die Bereitstellung anwendungsfähiger Konzepte und Instrumente für den Schulbetrieb. Der Bund beabsichtigt 250 Millionen Euro für die Initiative beizutragen. Die Länder steuern dagegen den Transfer der Ergebnisse in die bestehenden Strukturen sicher.
Regierungsbildung als letzte Unsicherheit
Auch wenn der Maßnahmebeginn ab 01.01.2025 datiert ist und die Länder bis Februar 2025 ihre Konzepte zur Umsetzung der Handlungsstränge einreichen sollten, gab es wegen der auslaufenden Legislaturperiode noch keine rechts- und haushaltsverbindliche Vereinbarung auf Bundes- und Landesebene. Erst nach Abschluss der Koalitionsverhandlungen wird der Bundeshaushalt 2025 final beschlossen. Bis dahin bleibt die Bundesregierung allerdings über die vorläufige Haushaltsführung handlungsfähig. Dass der Digitalpakt 2.0 von der neuen Regierung gekippt wird ist unwahrscheinlich, aber die Vereinbarungsentwürfe werden erst unter der neuen Regierung von Bund und Ländern unterzeichnet.
Kritik am Digitalpakt 2.0
Die Fortsetzung des Digitalpakts ist wichtig, allein schon um den begonnenen Wandel fortzuführen. Doch bereits der DigitalPakt Schule hatte eigentlich aufgezeigt, dass es nicht nur an finanziellen Mitteln, sondern auch an Konzepten und Strukturen für ihre Umsetzung mangelt. So berichtete der SWR am 25.03.2025 davon, dass von den 1.754 bewilligten Anträgen in Baden-Württemberg ganze 527 Schulträger noch keinen Verwendungsnachweis vorgelegt haben. Der ist nötig, damit die Förderung nicht verfällt. Schulträger sind oft Gemeinden, Landkreise und Bundesländer, teils aber auch natürliche und juristische Personen. Eine Fristverlängerung soll es nicht geben.
Zu diesen noch immer vorhandenen strukturellen Problemen gesellt sich auch Kritik am Konzept des Digitalpakt 2.0. Fabian Schön, Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz machte in einem Interview zum Digitalpakt 2.0 deutlich, dass das Finanzvolumen allenfalls ausreicht, um den aktuellen Stand der Digitalisierung zu halten. Dazu benennt er auch, dass sowohl Bund als auch Länder in der Evaluierung des Digitalpakt 1.0 zum Schluss kamen, dass dieser nicht weitreichend genug war. In der Praxis mangelt es laut Schön vor allem an der Fortbildung, damit Lehrer die neuen digitalen Mittel richtig nutzen und zugleich selbst Digital- und Medienkompetenz lernen und weitervermitteln können.
Auch der deutsche Lehrerverband spricht sich für eine Aufstockung des Digitalpakt 2.0 aus und benennt ebenso die Schulung der Lehrkräfte und Personalkosten für eine notwendige IT-Administration – die übrigens an vielen Schulen noch „nebenher“ von Lehrern übernommen wird.
Der sächsische Lehrerverband findet sogar drastischer Worte. Laut Vorsitz Michael Jung wirkt der Digitalpakt 2.0 „wie ein Pflaster auf einer tiefen Wunde. Er mag kurzfristig für Erleichterung sorgen, bietet aber keine umfassende und zukunftsfähige Lösung für die digitale Bildung an unseren Schulen.“ Wie viele andere Stimmen, kritisiert der SLV auch die zeitliche Begrenzung bis 2030. Einig sind sich nämlich fast alle: Schulen benötigen eine dauerhafte Unterstützung mit Perspektive und keine Förderprogramme für einzelne Projekte.
Außerdem: Aktionsplan für digitale Bildung der EU (2021-2027)
Neben unserem deutschen Digitalpakt gibt es auf EU-Ebene auch noch den Aktionsplan für digitale Bildung. Die Initiative wurde zur Umsetzung der Europäischen Kompetenzagenda und dem Digitalen Kompass 2030 geschaffen. Ihr Ziel ist es, einen gemeinsamen europäischen Bildungsraum zu schaffen. Als starkes Europa stellt sich die EU ebenfalls in Sachen KI-Gesetze (AI-Act) und Digitale Märkte (Digital Markets Act & Digital Services Act) auf.
Zu den Maßnahmen zählen unter anderem ein gemeinsamer Rahmen für digitale Bildungsinhalte, die internationale Vernetzung, Aufbau von Kompetenzen und ethische Richtlinien für KI-Nutzung. Für die Umsetzung der Maßnahmen sind allerdings die Länder selbst zuständig. Dafür benötigt es dann also wieder den DigitalPakt, um die Umsetzung finanziell abzusichern. Der aktuelle Aktionsplan für digitale Bildung der EU läuft allerdings nur bis 2027. Danach dürfte ein neuer eventuell nochmals konkreterer Aktionsplan folgen.
Image by ChatGPT (KI-generiert)
Artikel per E-Mail verschicken