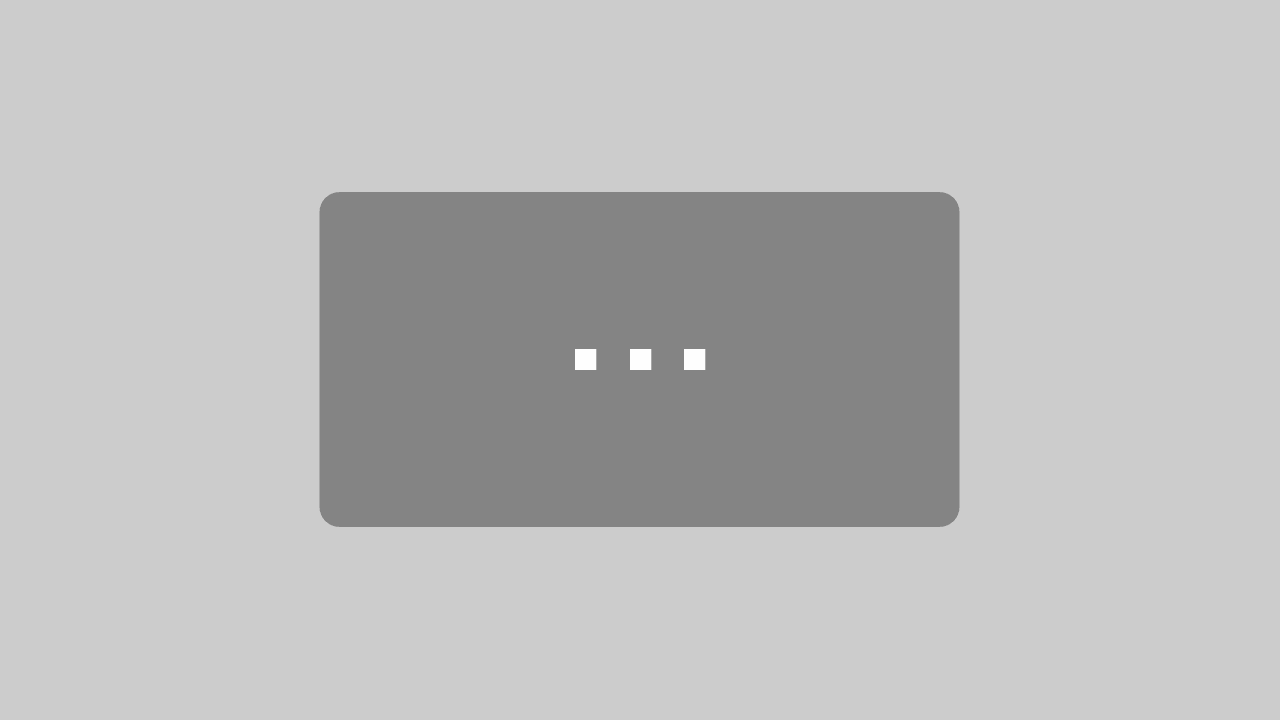Die Medienlogik hinter „If it bleeds it leads“ zwingt Reporter immer näher an das Geschehen, bis sie selber ein Teil der Berichterstattung werden. // von Russell Frank

Lillian Ross, langjährige Mitarbeiterin und Autorin im New Yorker Magazine, ermahnte aufstrebende Reporter, diese sollen nicht über sich selbst schreiben. „Ein Reporter bedient das Thema“, schrieb sie, „und nicht sich selbst. Sagen Sie nicht ‚Schau mich an. Schau, was ich für ein toller Reporter bin!'“ Klingt ein bißchen kurios in Zeiten des Selfies, oder?
Der Nachrichtensprecher der NBC News. Brian Williams, zog alle Aufmerksamkeit auf sich, als er seine dramatische Geschichte von einem Hubschrauberabsturzes erzählte. Im Jahr 2003 will er im Irak von einer Rakete getroffen worden sein. Nun wünscht er sich sicherlich, er wäre bei dem Thema an sich geblieben.
Die Ironie dabei ist, dass sich Williams durch seine Helikoptergeschichte und dadurch, dass er sich hier fälschlicherweise selbst eingebracht hat, unfreiwillig in das Zentrum einer viel größeren Thematik über journalistische Ethik katapultiert.
Um nachzuvollziehen, wie einer der weltweit meist respektierten Fernsehjournalisten Gefahr läuft, seinen Posten als Anchorman zu verlieren, muss man diese Geschichte als die folgerichtigen Auswirkungen der Tendenzen erkennen, die sich seit Jahrzehnten bei den Sendern entwickelt haben.
Marty Moss-Coane diksutiert die Kontroverse um Williams und Prinzipien journalistischer Ethik:b
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von w.soundcloud.com zu laden.
Unser Mann vor Ort
Fernsehnachrichten werden als „Stand-up“ bezeichnet, also die visuelle Version der Verfasserzeile im Printjournalismus. Für die Reporter stellt dies eine Möglichkeit dar, den Zuschauern zu zeigen, dass sie vor Ort sind und die Neuigkeiten aus erster Hand erhalten.
Solche Art Bildmaterial wirkt umso beeindruckender, wenn wir den Reporter mit Helm und Kampfanzug sehen. Die Nachricht lautet: Unser Mann befindet sich gerade in Vietman oder Irak oder Afghanistan oder wo auch immer gerade das aktuelle Geschehen stattfindet und ist nicht nur Augenzeuge der Kriegsgefahren, sondern setzt sich dieser Gefahr auch selbst aus, und dies auch noch um unseretwillen, damit wir informiert sind. Deshalb sollen wir von seinem Mut entsprechend beeindruckt und dankbar sein.
Von dort ist es nur noch ein kleiner Schritt hin zu Reportern, die selbst eine aktive Rolle in ihrer eigenen Berichterstattung einnehmen. Dies taten beispielsweise Anderson Cooper von CNN, als er einen verletzten Jungen in Sicherheit brachte, oder Dr. Sanjay Grupta, als er Überlebende nach dem Erdbeben in Haiti im Jahr 2010 pflegte.
Wenn ich solche Spektakel mit ansehe, stelle ich mir Sportreporter vor, die vom Pressegraben zum Umkleideraum sprinten, sich umziehen und direkt hinaus aufs Spielfeld laufen. Aber während die Traditionalisten, zu denen ich mich auch zähle, noch über diese Art der Selbstdarstellung murren, scheint das Publikum das Ganze vollkommen zu akzeptieren. In dem Fall erscheint eine Berichterstattung, die losgelöst ist vom menschlichen Leid, eher herzlos und ausbeuterisch. Die Fans wollen, dass Cooper und die Anderen ihr Entsetzen und ihre Besorgnis ausdrücken und teilen, und wenn es nötig ist, zu guten Samaritern werden.
Deshalb schicken heute die leitenden Redakteure ihre Reporter so oft wie möglich aus dem Studio und mitten ins Geschehen, vorzugsweise mit Explosionen in der Luft und Opfern, die um Hilfe rufen. So werden die Schreibtischtäter zu Actionhelden umgewandelt. Nach Möglichkeit sind das dann solche mit gut definierten Muskeln, die sich unter engen T-Shirts wölben.
Beinahe berühmt
In so einem Umfeld ist verständlich, weshalb Williams unbedingt seinen eigenen dramatischen Moment haben wollte. Dennoch war der Hubschrauber, in dem er sich befand, erst als Zweiter am Ort des Geschehens, nachdem der erste Hubschrauber vom Raketenfeuer zerstört worden war. Näher kam Williams nicht heran. Deshalb änderte er seine Geschichte ab, er berichtete nicht mehr über das zerstörte Fluggerät, wie er es noch 2003 getan hatte, sondern behauptete zehn Jahre später, er selbst wäre mit an Bord gewesen.
Und ein bißchen verständlich erscheint es einem auch, wenn man sich vorstellt, wie viel besser beispielsweise auch meine Stories wären, wenn ich vorgeben würde, Zeuge von historischen Ereignissen gewesen zu sein, die ich beinahe erlebt habe. Ich wollte 1969 zum Woodstock-Festival fahren, aber meine Eltern erlaubten es mir nicht. Im Jahr 1989 wäre ich beinane in Nordkalifornien gewesen und hätte das Erdbeben miterlebt, aber eigentlich war ich 120 Meilen östlich in der Bay Area. Von dem Erdbeben habe ich durch die Sportreporter Al Michaels und Tim McCarver erfahren. Ich war im Jahr 2013 in der Ukraine, aber bevor die Revolution losging, fuhr ich wieder.
Die Soldaten, die mit auf der Mission im Irak waren, waren nicht ganz so gnädig. Als sie ihn zwangen, Farbe zu bekennen, beteuerte Williams, er habe einen „Fehler begangen“. Seine Verteidiger merkten an, dass die Erinnerung uns allen Streiche spielt. Seine deutlich zahlreicheren Kritiker empfanden es als schwer vorstellbar, wie man eine Situation, in der es um Leben oder Tod geht, mit einem nicht lebensgefährlichen Erlebnis „verschmelzen“ kann – so die Bezeichnung von Williams. In Zeiten, in denen Journalisten zunehmend einen Teil der Story ausmachen, über die sie berichten, sind es Leute wie Williams, die dazu verführt werden, ihre Erlebnisse auszuschmücken, um ihr Image aufzubessern?
Cenk Uygur von „The Young Turks“ kommentiert den Fall von Brian Williams:
Moralischer Verfall
Während dieser Text entstanden ist, haben mehr als 1200 Leser ihren Kommentar zu dem neuesten Bericht über diesen Skandal in der New York Times gepostet. Manche von ihnen sind Zyniker, die nicht verstehen können, wieso überhaupt jemand Integrität von einem Journalisten erwartet. Manche können nicht nachvollziehen, wieso überhaupt so ein Wirbel um einen Journalisten gemacht wird, während die Politiker sowieso die ganze Zeit lügen. Und manche suchen immer noch den nächsten Onkel Walter (hier ist der Journalist Walter Cronkite gemeint), sind todunglücklich darüber, dass ein bis dahin vertrauenswürdiger Journalist sich als vertrauensunwürdig herausgestellt hat. Sie sind fertig mit Williams und sie sind fertig mit Fernsehnachrichten.
Währenddessen nimmt Williams‘ Entschuldigung ihren Platz zwischen den Entschuldigungen so vieler anderer öffentlicher Personen ein, die wir schon gehört haben. Diese schrecken meist davor zurück, zuzugeben, dass es sich bei ihrem Fall um moralischen Verfall handelt und bezeichnen diesen viel eher als „Ausrutscher“.
Die Öffentlichkeit hat offensichtlich genug von den „Versprechern“, „Verschmelzungen“ oder „unklaren Erinnerungen“. Wenn Williams zugeben würde, dass er gelogen hat, und erklären wüde, wieso er das getan hat, sähe es vielleicht besser für ihn aus.
Zuerst erschienen auf theconversation.com und steht unter CC BY-ND 4.0. Übersetzung von Anne Jerratsch.
Teaser & Image by NBC News
Artikel per E-Mail verschicken
Schlagwörter: Berichterstattung, Brian Williams, Ethik, journalismus, Medienwandel, Reporter