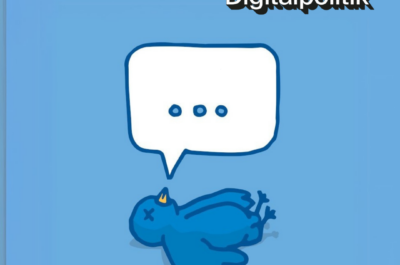Die Entscheidung von Facebook, ein Posting eines Norwegers zu blockieren, das ein Bild beinhaltete, das einst den Pulitzerpreis gewann und ein verängstigtes und nacktes Mädchen zeigt, das vor einer Napalm-Attacke während des Vietnamkriegs flieht, wurde von Journalisten und anderen Vertretern der Meinungsfreiheit mir einem Aufschrei der Empörung aufgenommen.
Der norwegische Autor Tom Egeland hatte das Bild auf seiner Facebookseite als einen Teil der Reihe „Sieben Fotos, die die Geschichte der Kriegsführung veränderten“ gepostet. Sein Nutzerkonto auf Facebook wurde anschließend blockiert. Als die norwegische Aftenposten hierüber berichtete und dabei auch das Bild in der Berichterstattung zeigte und es auf Facebook postete, wurde das Bild auch hier geblockt. Facebook zitierte seine Richtlinien, die das Hochladen von Bildern, welche nackte Kinder zeigen, als Teil ihres Kampfes gegen die Kinderpornographie auf der Plattform verbieten.
Von nun an gerieten die Dinge vollends außer Kontrolle. Die Zeitung bildete das Foto quer über seiner Titelseite ab (das Gleiche taten auch andere Nachrichtenkanäle, einschließlich des Guardian in Großbritannien), gefolgt von einem Brief, der mit „Lieber Mark Zuckerberg“ betitel wurde, verfasst von dem Herausgeber Espen Egil Hansen. Hansen drückte seine Befürchtungen aus, dass „der mächtigste Herausgeber der Welt“, der verantwortlich ist für „das wichtigste Medium der Welt“, seiner Meinung nach „die Freiheit einschränkt, statt versucht, sie zu vergrößern.“
Norwegens Premierministerin Erna Solberg schaltete sich auch ein, indem sie die „zutiefst zu bedauernde“ Entscheidung einen Versuch nannte, „unsere gemeinsame Geschichte zu editieren.“ Der CEO des Index of Censorship, Jodie Ginsberg, drückte es noch unverblümter aus: „Absolut idiotisch“, verkündete sie. Journalisten, Politiker und andere Menschen auf der ganzen Welt publizierten das Bild erneut als eine Form des Protests und als ein Zeichen der Solidarität.
Nach ein paar Tagen machte Facebook einen Rückzieher. Es stellte das Foto wieder ein und zitierte seinen „ikonischen Status als Bild mit einer historischen Bedeutung“ was, wie gesagt wurde, „schwerer wiegt als der Schutz der Gemeinschaft durch seine Entfernung.“ Das Unternehmen versprach, „unsere Rezensions-Mechanismen anzupassen“ und sich mit „Herausgebern und anderen Mitgliedern unserer globalen Gemeinschaft bezüglich dieser wichtigen Fragen, die vor uns liegen“, zusammen zu tun. Es war eine gute, wenn auch verspätete Entscheidung. Aber war es ein Sieg für die Meinungsfreiheit? Nicht grundsätzlich.
Zweimal falsch über ein richtig
Facebooks ursprüngliches Argument, dass das Posten des ikonischen Fotos es anschließend schwerer machen würde, das Posten von Fotos anderer nackter Kinder zu verbieten, war wohl unaufrichtig, aber auch einfach falsch. Eine Firma mit den offensichtlichen und tatsächlich unglaublichen technischen Erfahrungen, über die sie sicher verfügt, kann bestimmt einen Algorithmus entwickeln, der solche Kennzeichen wie den Pulitzerpreis berücksichtigt, wenn eine Veröffentlichungs-Aufforderung gemacht wird.
Auch wenn es hier zunächst größere Schwierigkeiten mit den Algorithem gibt, die solche Entscheidungen über die Veröffentlichung treffen, mit der Hilfe von Menschen oder auch ohne, sollte das Problem in diesem speziellen Fall gar nicht erst aufgetaucht sein. Aber die Herausgeber stehen mit der Entscheidung auch auf tönernen Füßen, wenn sie Facebook vorschreiben wollen, was es veröffentlichen darf und was nicht. Es ist tatsächlich ironisch, dass sie denken, das zu tun wäre angemessen, wenn nicht sogar die richtige Verhaltensweise. Um zu verstehen, wieso dies geschehen ist, muss man sich die verständliche Wut vorstellen, wenn es andersrum wäre: wenn eine dritte Plattform (oder auch jeder andere) versuchen würde, einem Journalisten vorzuschreiben, welche Artikel er oder sie verfassen soll und wie diese wiedergegeben werden dürfen.
Die Pressefreiheit vermittelt das Recht, freie Entscheidungen darüber zu treffen, über was berichtet wird, wie berichtet wird und was mit den Informationen passiert, nachdem man über diese verfügt. Es ist die Freiheit zu entscheiden, was man sagt, genauso wie, wann und wo und wie man es sagt. Sie vermittelt auch das Recht, gar nichts zu sagen.
Jeder Herausgeber muss über diese Freiheit verfügen, wenn sie irgendeine Bedeutung hat – einschließlich, ja, einschließlich Facebook. Entgegen seiner kürzlichen, komplizierten Versuche, sich selbst als eine „Technikfirma“ oder Plattform zu definieren, statt als eine „Medienfirma“, ist es ganz klar beides.
Eine Entscheidung Facebooks, bestimmte Teile einer Information nicht erscheinen zu lassen, könnte eine schlechte Entscheidung sein – ob es auf den Richtlinien basiert oder eher auf einem Algorithmus, in den einige Kleinigkeiten noch eingebaut werden müssen – aber es ist weder Tyrannei noch Zensur. Das Unternehmen hat anderen Menschen nicht gesagt, was sie mit dem Foto machen können oder sollten. Es hat eher sein Recht ausgeübt, die Entscheidung in Verbindung mit dem Bild auf seiner eigenen Seite zu treffen.
Die Macht der Plattform
Was die Angelegenheit trotz allem noch verzwickter macht, ist, dass die Aftenposten mit ihrer umfassenden Anklage recht hat, dass Facebook über noch nie dagewesene globale Macht bei dem Fluss von Informationen verfügt. Aber diese Macht über die Presse, die von bedeutendem Ausmaß ist, unterscheidet sich eigentlich ziemlich von der Zensur, wie sie traditionellerweise und auch juristisch definiert wird.
Facebook kann es nicht verhindern, wenn etwas für die Öffentlichkeit sichtbar werden soll, da es keine Kontrolle darüber hat, was die Verfasser veröffentlichen oder was andere Nutzer über ihre eigenen Kanäle senden. (Selbst Einzelpersonen wie der Autor Egeland können Informationen unter anderem durch ihren Blog verbreiten, neben vielen weiteren Optionen.)
Die Macht, die Facebook dennoch hat, ist die, die Sichtbarkeit eines Inhalts auszudehnen, nachdem es veröffentlicht oder geschickt wurde. Im Gegenzug ist diese Sichtbarkeit, wenn Facebook sich dazu entschließt, die Macht der erweiterten Sichtbarkeit nicht einzusetzen – wie es ein Recht dazu hat – deutlich begrenzt. Und noch wichtiger: geschätzte 40 Prozent der Besucher einer Nachrichtenseite kommen ursprünglich von Facebook, die Prozentzahl ist somit sogar höher als die von Google. Das Problem für die kommerziellen Medien ist somit primär ein ökonomisches – ihre Fähigkeit, Einnahmen zu erzielen, hängt völlig davon ab, ob die Leute ihre Waren sehen (und sich im Idealfall auf diese einlassen) und von den Informationen, die sie produzieren und liefern – und nur im weiteren Sinn ein Problem der Editierung.
Die derzeitige Gesetzgebung tendiert dazu, die ökonomischen und die redaktionellen Bereiche separat zu behandeln: den ersten als eine primär kommerzielle Angelegenheit und den zweiten als eine Problematik der zivilen Freiheit, zu dem beispielsweise auch die Meinungsfreiheit gehört. Ein solches zwiespältiges Verständnis funktioniert gut genug, wenn die beiden Parteien zugleich die Schaffung der Inhalte sowie deren Verteilung kontrollieren. Aber im vergangenen Jahrzehnt veränderte sich die Situation mit der unaufhaltsamen Zunahme und dem exponentiellen Wachstum von externen Plattformen. Medienkonzerne produzieren ihre Inhalte nicht mehr alle selbst (zum Beispiel verlassen sie sich immer mehr auf Material, das durch die Nutzer geschaffen wurde) und sie kontrollieren eine abnehmende Anzahl der Art und Weisen, wie diese zugänglich sind.
Ihre Reichweite ist auf diese Weise eingeschränkt durch die Verfügbarkeit ihres Inhalts auf dem Informations-Lieferungs-Mechanismus einer anderen Person. Zusätzlich zu Facebook und Google umfassen diese Mechanismen Twitter, YouTube (das zu Google gehört), Yahoo! und ein schnell zunehmende Anzahl anderer Technologien des „social Sharing“. In anderen Worten liegt die Effektivität der Nachrichtenfirmen und möglicherweise auch ihr Überleben, zumindest bis zu einem gewissen Grad, nicht in ihren Händen. Die Situation ist beängstigend und frustrierend zugleich. Der Herausgeber der Aftenposten verkündete auf seiner Titelseite mit seinem „Brief“ an den Facebook-Chef: „Redakteure können mit dir als Meister-Redakteur nicht leben.“ Und obwohl er es nicht gesagt hat, als einen Meister-Herausgeber ebenfalls nicht.
Dennoch müssen sie mit Zuckerberg und seinen Kollegen leben – irgendwie. In der voraussehbaren Zukunft werden Inhalte geteilt, aber die Dimensionen, in diesen dieser geteilte Inhalt erscheint, wird der Kontrolle diverser Entitäten unterliegen, die über verschiedene Organisationskulturen und verschiedene Vorstellungen, was einen wertvollen Inhalt ausmacht und über verschiedene ökonomische Interessen verfügen. Der unvermeidbare Kampf um diesen höchst umstrittenen Schauplatz hat jede Menge Auswirkungen – nicht nur für die Medien- und Technologieunternehmen, welche direkt involviert sind, sondern auch für Millionen von Menschen, die sich darauf verlassen, dass beide ihre Arbeit verrichten – und zusammenarbeiten.
Dieser Artikel erschien zuerst auf „The Conversation“ unter CC BY-ND 4.0. Übersetzung mit freundlicher Genehmigung der Redaktion.
Image „Facebook“ by FirmBee (CC0 Public Domain)
Artikel per E-Mail verschicken
Schlagwörter: facebook, freiheit, journalisten, kinderpornografie, Meinungsfreiheit, Nutzerkonto, Plattform, posting, protest, Pulitzerpreis, Richtlinien

![facebook(image by FirmBee[CC0 Public Domain] via Pixabay)](https://www.netzpiloten.de/wp-content/uploads/2016/09/facebook-1140x500.jpg)