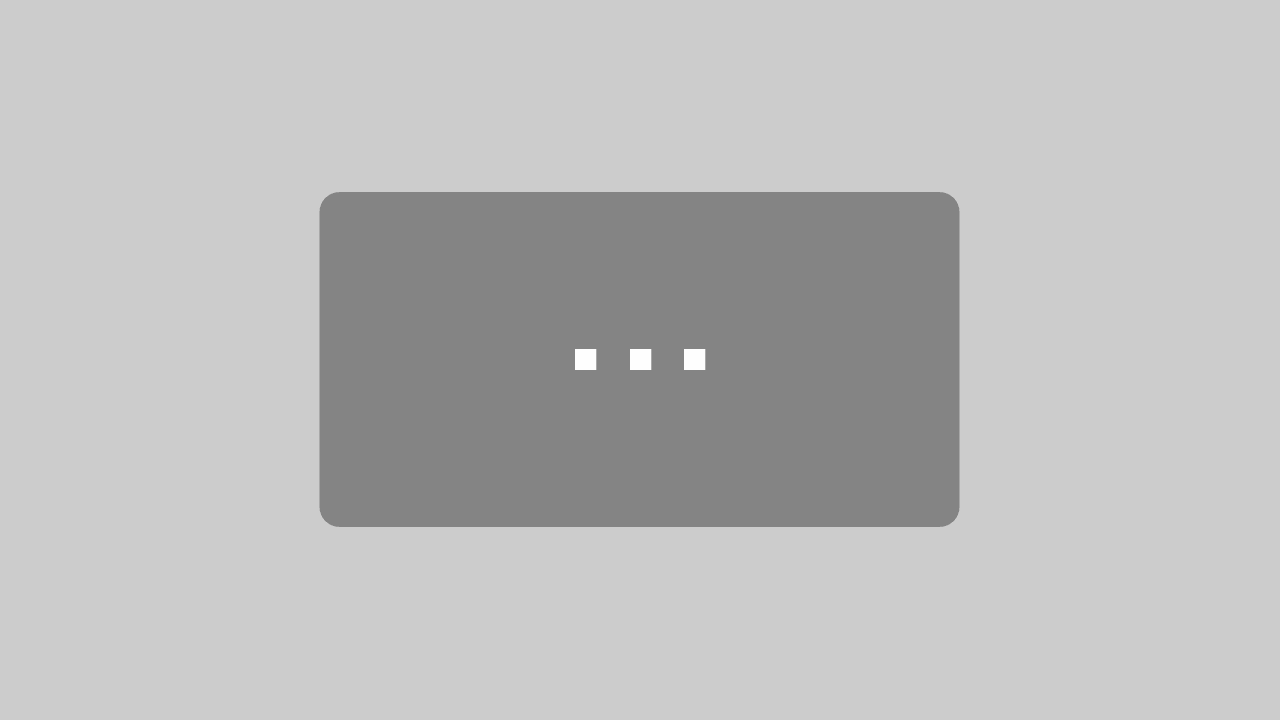Das 1925 gegründete Magazin New Yorker erfindet sich digital neu. Fünf Gründe, warum die Transformation gelingen kann. „Es ist schwer zu sagen, was der New Yorker im Internet macht. Sie posten die besten Texte nicht online – außer wenn sie es doch tun. Die besten Autoren bloggen nicht – oder doch„. Es war im Winter letzten Jahres, als das Literaturmagazin n+1 süffisant anmerkte, dass die Online-Strategie des New Yorker offenbar ist, keine Strategie zu haben. Das hat sich diese Woche geändert.
In einem „Brief an die Leser“ erklärt die Redaktion die Veränderungen: Alle Artikel seit 2007 sind online, teilweise auch Scans bis zurück ins Gründungsjahr 1925, es gibt zusätzliche Blogs. Dazu ein neues Design auf WordPress-Basis und bis zum Herbst ist alles frei zugänglich, danach kommt es eine Metered Paywall.
Fünf Gründe, warum es der New Yorker schaffen könnte, ein funktionierendes, digitales Geschäftsmodell zu finden:
1. Streber in Sachen Design
Die offensichtlichste Veränderung betrifft das Design der Webseite. Viele weiße Flächen, größere Schrift, fixe Navigation: Das Aussehen folgt den momentanen Design-Trends und gängigen Usability-Regeln, mit den typischen Schriftarten bleibt dennoch Individualität erhalten. Der Guardian schreibt metaphorisch: „Die Seite sieht immer noch aus wie der New Yorker, aber mit mehr Raum zum Atmen in der U-Bahn„.
Für die technische Umsetzung hat sich der Condé-Nast-Verlag für das Content-Management WordPress entschieden, wie schon bei Wired. Ein kluger Schachzug war dabei, den Webentwickler Michael Donohoe als Director of Product Engineering zu engagieren. Donohoe war bereits bei der New York Times tätig und zuletzt beim Launch des oft gelobten Wirtschaftsmagazins Quartz federführend dabei – auch dort wird WordPress genutzt.
Mit dem Redesign hat der New Yorker keine offensichtlichen Schnitzer in Sachen Usability erlaubt – auch weil sie dort genau wissen, dass das Auswirkungen auf den Erfolg der Paywall haben wird: „Es ist in unserem ökonomischen Interesse, das Lesen so leicht wie möglich zu machen, denn dann werden Leute lesen und die Texte teilen“, sagt Online-Redakteur Nicholas Thompson dem Magazin Capital.
2. Die Paywall hat mehrere Monate Vorlaufzeit
Ab Herbst soll eine Metered Paywall wie bei der New York Times gelten. Eine bestimmte Anzahl von Artikeln ist dann kostenfrei zu lesen. Wer mehr will, muss ein Abo abschließen.
Spannend ist dabei: In den kommenden Monaten will Condé Nast laut New York Times Daten sammeln, um die optimale Paywall zu installieren. Wie viele Texte sind frei? Sind nur Printartikel beschränkt oder auch Blogbeiträge? Was ist mit Podcasts oder Karikaturen? Sich mit dieser Entscheidung auf empirische Erhebungen zu verlassen, ist schlau.
Ökonomisch sind Metered Paywalls eine Preisdifferenzierung durch zwei verschiedene Versionen. Die Ökonomen Carl Shapiro und Hal Varian empfehlen in ihrem Standardwerk „Information Rules“ bei einer solchen Konstellation zwei Regeln: Erstens, den Preis für die kostenpflichtige Variante nicht zu hoch ansetzen, um das Abo relativ gesehen attraktiver zu machen. Und zweitens, die Qualität des kostenlosen Angebots schlechter zu machen – also weniger Texte pro Monate zur Verfügung stellen. Wo diese Schwelle genau liegen sollte, kann aus den in der Zwischenzeit erhobenen Daten gewonnen werden. Man kann gespannt sein, wie der New Yorker die Preise und die frei verfügbare Menge setzt.
3. Die Bezahlschranke ist gut für die Leser
Erst die konsequente Ausrichtung des Verlags auf das Internet macht es möglich, dass wirklich alle Texte auch online zu finden sind. Ein größeres Angebot – also gut für die Leser.
Natürlich handelt der New Yorker nicht selbstlos: Das Archiv soll neue, am besten zahlende Kunden gewinnen; ältere Texte können wiederverwertet werden. Für Konsumenten ist das trotzdem vorteilhafter als bisher, die bisher von der New York Times als „unberechenbar“ bezeichnete Auswahl der Texte aus der Printausgabe, die online gestellt wurden.
Dieses viel größere Angebot ruft die Kuratierer auf den Plan: In den letzten Tagen gab es bereits eine ganze Reihe von Listen, mit Texten, die man unbedingt lesen soll. Bei „The Awl“ sind mehrere solcher Auflistungen aggregiert.
Eine Session auf dem New Yorker Festival 2011 beschäftigt sich mit dem Alltag im Magazin:
4. Grenzen innerhalb der Redaktion weichen auf
Der neue Kurs hat auch Folgen für die Redaktion, deren Trennung zwischen Print und Online zwangsläufig aufbrechen muss. Denn laut Capital werde an einer neuen Gehaltsstruktur gearbeitet, um der neuen Strategie gerecht zu werden. Für festangestellte Redakteure sind in den bisherigen Verträgen alle Blogbeiträge abgegolten. Das verändert sich gerade: 250 US-Dollar zahle das Magazin pro Blogbeitrag mittlerweile.
Auch beim für sein Fact-Checking bekannte Magazin, herrscht ein bisher ein klaren Ungleichgewicht pro Print: Von 15 Faktenprüfern ist nur eine Person für die Online-Ausgabe abgestellt. „Das ist wahrscheinlich immer noch einer mehr als allen anderen„, sagt Redakteur David Remnick zu Capital. Wenn nun künftig alle Artikel automatisch auch online erscheinen, bricht diese strikte Trennung auf.
5. Die Kombination macht’s
Beim New Yorker haben sich die Verantwortlichen dafür entschieden, den Schritt Richtung bezahlte Inhalte zu machen – und zwar ganzheitlich: Eine Paywall ohne wirklich nutzerfreundliches Design hat wahrscheinlich wenig Sinn, genauso wie tolles Aussehen der Webseite ohne die Texte aus dem gedruckten Heft.
Das Traditionsmagazin könnte verschiedene Eigenschaften auf sich vereinen, um die digitale Weiterentwicklung zu schaffen: Reputation und Qualitätsinhalte, nutzerfreundliche Webseite, ein globales Publikum. Und nicht zu vergessen: Noch immer verkaufen sich mehr als eine Million gedruckte Hefte pro Ausgabe – aus finanzieller Not handelt der Verlag deshalb wahrscheinlich nicht, sondern aus Weitsicht. Way to go, New Yorker!
Image (adapted) „New York“ by melissamahon (CC0 Public Domain)
Artikel per E-Mail verschicken
Schlagwörter: journalismus, magazin, Medienwandel, New Yorker, Transformation

![New York (adapted) (Image by melissamahon [CC0 Public Domain] via Pixabay)](https://www.netzpiloten.de/wp-content/uploads/2015/07/New-York-adapted-Image-by-melissamahon-CC0-Public-Domain-via-Pixabay-555x600.png)